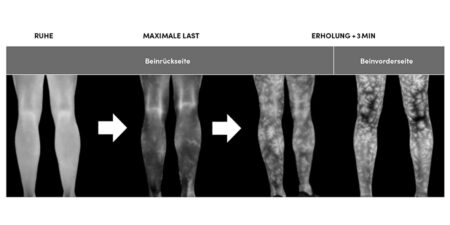„Krafttraining in der Follikelphase, wenn der Östrogenspiegel hoch ist“, „Ausdauertraining in der Lutealphase, wenn Progesteron dominiert“ – so oder ähnlich liest man es zunehmend in sozialen Netzwerken, aber auch vermehrt in Fachbeiträgen. Die Vorstellung, Frauen könnten ihre Trainingsinhalte und -intensitäten gezielt an die verschiedenen Phasen ihres Menstruationszyklus anpassen, sodass das Training an Effizienz gewinnt, erscheint durchaus plausibel und verlockend.
Doch wie belastbar ist die derzeitige wissenschaftliche Evidenz für die Theorie eines zyklusbasierten Trainings? Mit diesem Beitrag soll das Thema kritisch beleuchtet und eine fundierte Diskussionsgrundlage für die weitere Auseinandersetzung in Sportwissenschaft und -praxis geschaffen werden.
Der menschliche Menstruationszyklus dauert im Durchschnitt 28 Tage und wird klassischerweise in zwei Hauptphasen unterteilt: die Follikelphase und die Lutealphase [1]. Der Eisprung markiert den Übergang von der Follikel- zur Lutealphase und geht mit veränderten Hormonsekretionen (z. B. Östradiol, Progesteron, follikelstimulierendes und luteinisierendes Hormon) einher.
D’Souza et al. [2] weisen in einer umfassenden Übersichtsarbeit darauf hin, dass der Menstruationszyklus aber eine erhebliche inter- und intraindividuelle Variabilität aufweist. So kann die Zykluslänge zwischen 21 und 35 Tagen schwanken. Selbst bei Frauen mit regelmäßigem Zyklus können die relativen Hormonkonzentrationen stark variieren [2]. Dieses komplexe Geschehen unterscheidet sich deutlich von der vereinfachten Darstellung, die häufig in Lehrbüchern oder populärwissenschaftlichen Quellen zu finden ist. Ein weiterer relevanter Aspekt, auf den Nolan et al. [3] hinweisen, ist, dass ein erheblicher Anteil der weiblichen Bevölkerung (28 bis 43 %) hormonelle Kontrazeptiva verwendet – am häufigsten in Form oraler Verhütungsmittel („Pille“). Diese führen zu einer vollständigen Suppression der endogenen Hormonspiegel, wodurch generelle Trainingsempfehlungen auf Basis „typischer“ Zyklusverläufe noch weniger Aussagekraft besitzen.
Im Hinblick auf chronische Trainingsanpassungen gehört die Annahme zyklusabhängiger Veränderungen des Energiestoffwechsels zu den zentralen Argumenten der Befürworter eines zyklusorientierten Trainingsansatzes.
Demnach sollen Kohlenhydrate und Fette je nach Zyklusphase unterschiedlich metabolisiert werden [4 – 6]. So wird etwa postuliert, dass High-Intensity-Intervalltraining in der Lutealphase besonders vorteilhaft sei, da Progesteron die Kohlenhydratoxidation begünstige und somit die Energiebereitstellung für intensive Belastungen verbessere. Diese Hypothese stützt sich jedoch vornehmlich auf isolierte Zellstudien oder tierexperimentelle Modelle [7]. Eine umfassende Metaanalyse aus dem Jahr 2023, die 55 Studien einbezog, konnte hingegen keinen signifikanten Unterschied in der Energiebereitstellung zwischen Follikel- und Lutealphase beim Menschen feststellen – weder in Ruhe noch unter Belastung [2]. Dieses Ergebnis widerspricht somit der Annahme, dass ein Training auf Grundlage vermeintlicher metabolischer Unterschiede zwischen Zyklusphasen besonders wirksam sein könnte. Zell- und Tiermodelle zeigten darüber hinaus einen Einfluss von Sexualhormonen (z. B. Testosteron, Östrogen, Progesteron) auf die mitochondriale Biogenese [8, 9] und legen damit eine potenzielle zyklusbedingte Beeinflussung chronischer Anpassungen an Ausdauertraining nahe. Für den Menschen ist die Datenlage diesbezüglich jedoch inkonsistent, spärlich und bislang nicht überzeugend.
Bezüglich des akuten Einflusses der Zyklusphase auf die Ausdauerleistungsfähigkeit lassen sich in der Literatur vereinzelt Hinweise auf zyklusabhängige Schwankungen der VO₂max finden [10 – 12]. Andere Studien berichten hingegen von keinen nennenswerten Unterschieden [13, 14]. So zeigte etwa eine Untersuchung von Taylor et al. [15] an hochtrainierten Ausdauerathletinnen, dass weder die frühe Follikelphase, die Ovulationsphase noch die mittlere Lutealphase einen signifikanten Einfluss auf verschiedene Ausdauertests (z. B. 30-Sekunden-All-out-Test, submaximaler Stufentest) hatten. Im Bereich der chronischen Anpassungen an Krafttraining wurde in einigen Studien berichtet, dass die Follikelphase im Vergleich zur Lutealphase Muskelzuwachs und Kraftentwicklung begünstigen könnte [16]. Eine kürzlich veröffentlichte Untersuchung von Oosthuyse et al. [17], die sich detailliert mit molekularen Mechanismen befasst, weist ebenfalls auf potenzielle Vorteile der Follikelphase im Hinblick auf Krafttraining hin. Die Autoren führen dies primär auf die anabole Wirkung von Östrogen zurück, das die Expression des Transkriptionsfaktors MyoD fördert. Dieser wiederum aktiviert muskuläre Satellitenzellen, die eine zentrale Rolle bei Prozessen der Muskelreparatur und des Muskelwachstums spielen [18].
Weitere Studien, die einen Vorteil eines zyklusbasierten Krafttrainings beim Menschen nahelegen, weisen jedoch teils erhebliche methodische Schwächen auf [2, 3, 19 – 21]. Kritisiert werden insbesondere eine unzureichende Verifikation der tatsächlichen Zyklusphase, die pauschale Annahme eines idealtypischen 28-Tage-Zyklus für alle Teilnehmerinnen, geringe Stichprobengrößen sowie das Fehlen einer Standardisierung potenziell einflussreicher Faktoren wie Ernährung, Schlaf und Stress. Auch die statistische Power vieler Studien ist als unzureichend zu bewerten. Zwei aktuelle, methodisch hochwertige Studien [19, 22] untersuchten mithilfe von Blutanalysen und Muskelbiopsien, ob sich die verschiedenen Phasen des Menstruationszyklus in vivo direkt auf die Muskelproteinsynthese auswirken und welchen Einfluss hormonelle Kontrazeptiva dabei haben. Die Ergebnisse zeigen übereinstimmend keinen signifikanten Einfluss der Zyklusphase oder der Anwendung hormoneller Verhütungsmittel auf die Muskelproteinsynthese. Diese Befunde werden durch weitere aktuelle Arbeiten internationaler Forschungsgruppen bestätigt [3].
Ein weiteres häufig angeführtes Argument der Befürworter zyklusbasierten Trainings ist eine angenommene hormonell bedingte Veränderung des Binde- und Stützgewebes – insbesondere der Sehnen – im Verlauf des Menstruationszyklus. Auch in diesem Bereich ist die Datenlage bislang sehr begrenzt. Die wenigen verfügbaren Studien [23 – 25] zeigen jedoch keine signifikanten Veränderungen der mechanischen Eigenschaften von Sehnen in den unterschiedlichen Zyklusphasen. Burgess et al. [23] und Hansen et al. [24] weisen allerdings darauf hin, dass hohe Serumöstradiolspiegel – unabhängig von der Zyklusphase – potenziell einen negativen Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften der Sehnen haben könnten. Auch hinsichtlich eines möglichen Zusammenhangs zwischen zyklusbedingten Hormonschwankungen und der Verletzungsanfälligkeit ist die Evidenzlage unzureichend. Eine systematische Übersichtsarbeit von Martinez-Fortuny et al. [26] kommt zu dem Schluss, dass das Verletzungsrisiko in der Ovulationsphase am höchsten sein könnte. Die Autoren analysierten acht Studien und diskutieren ebenfalls einen möglichen Einfluss von Östradiol als Erklärung. Sie betonen jedoch auch die geringe Anzahl qualitativ hochwertiger Untersuchungen in diesem Forschungsfeld.
Keine wissenschaftliche Evidenz, aber dennoch positive Erfahrungen?
Wenn zyklusbasiertes Training bislang nicht durch belastbare wissenschaftliche Evidenz gestützt wird, stellt sich die Frage, warum viele Athletinnen dennoch von positiven Erfahrungen berichten. Dafür lassen sich mehrere mögliche Erklärungen anführen. Erstens kann bereits die gesteigerte Achtsamkeit gegenüber dem eigenen Wohlbefinden – unabhängig von der Zyklusphase – vorteilhaft sein. Eine individualisierte Trainingssteuerung, die subjektive Faktoren wie Erschöpfung, Motivation und das persönliche Empfinden berücksichtigt, ist ein etabliertes und geschlechtsunabhängiges Prinzip effektiven Trainings. Zweitens spielt ein möglicher Placebo-Effekt eine bedeutende Rolle: Wenn Athletinnen glauben, dass ein bestimmter Trainingsansatz in einer spezifischen Zyklusphase besonders vorteilhaft ist, kann diese Erwartung allein bereits zu einer Leistungsverbesserung führen. So fanden Dam et al. [27] heraus, dass Leistungsschwankungen bei Frauen mit regulärem Zyklus nicht mit hormonellen Veränderungen korrelierten, sondern vielmehr mit psychologischen Faktoren wie Motivation, subjektiver Leistungswahrnehmung und allgemeinen Indikatoren des Wohlbefindens, etwa Schmerzen.
Fazit
In diesem Beitrag haben wir versucht, aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse prägnant darzustellen. Dabei wurde bewusst auf Arbeiten international renommierter Forschungsgruppen zurückgegriffen. Nach sorgfältiger Analyse der aktuellen Evidenz kommen wir zu dem Schluss, dass derzeit keine überzeugenden Belege dafür vorliegen, dass Frauen durch ein Training nach idealisierten Menstruationszyklusphasen systematisch profitieren. Leserinnen und Leser, die sich intensiver mit dem Thema befassen möchten, ermutigen wir ausdrücklich, die hier zitierten Veröffentlichungen in Gänze zu lesen. Für die (leistungs-)sportliche Forschung möchten wir zudem betonen, dass die häufig geäußerte Annahme, der Menstruationszyklus erschwere die Durchführung und Interpretation von Studien mit Sportlerinnen maßgeblich, empirisch nicht haltbar ist. Diese Einschätzung wird auch durch eine aktuelle Übersichtsarbeit von Elliott-Sale et al. bestätigt [21]. Abschließend möchten wir betonen, dass der Menstruationszyklus keinesfalls ignoriert werden sollte – insbesondere dann nicht, wenn Athletinnen unter zyklusassoziierten Beschwerden (z. B. Schmerzen) leiden, die Training und Leistungsfähigkeit spürbar beeinträchtigen. Wir plädieren deshalb für eine evidenzbasierte Trainingsplanung in Kombination mit einer vertrauensvollen, offenen Zusammenarbeit aller Beteiligten. Ziel sollte es sein, individuelle Unterschiede angemessen zu berücksichtigen. Selbst wenn idealisierte Zyklusverläufe nur geringen Einfluss auf den Trainingserfolg haben, kann das individuelle „Bauchgefühl“ der Athletinnen dennoch eine zentrale Rolle spielen.
Literatur
- Mihm M, Gangooly S, Muttukrishna S. The normal menstrual cycle in women. Anim Reprod Sci. 2011;124:229–36.
- D’Souza AC, Wageh M, Williams JS, Colenso-Semple LM, McCarthy DG, McKay AKA, et al. Menstrual cycle hormones and oral contraceptives: a multimethod systems physiology-based review of their impact on key aspects of female physiology. J Appl Physiol. 2023;135:1284–99.
- Nolan D, McNulty KL, Manninen M, Egan B. The Effect of Hormonal Contraceptive Use on Skeletal Muscle Hypertrophy, Power and Strength Adaptations to Resistance Exercise Training: A Systematic Review and Multilevel Meta-analysis. Sports Med. 2024;54:105–25.
- Beidleman BA, Rock PB, Muza SR, Fulco CS, Gibson LL, Kamimori GH, et al. Substrate oxidation is altered in women during exercise upon acute altitude exposure: Med Sci Sports Exerc. 2002;34:430–7.
- Influence of oestrogen on muscle glycogen utilization during exercise. Acta Physiol Scand. 1999;167:273–4.
- Zderic TW, Coggan AR, Ruby BC. Glucose kinetics and substrate oxidation during exercise in the follicular and luteal phases. J Appl Physiol. 2001;90:447–53.
- Isacco L, Duché P, Boisseau N. Influence of Hormonal Status on Substrate Utilization at Rest and during Exercise in the Female Population: Sports Med. 2012;42:327–42.
- Galmés-Pascual BM, Nadal-Casellas A, Bauza-Thorbrügge M, Sbert-Roig M, García-Palmer FJ, Proenza AM, et al. 17β-estradiol improves hepatic mitochondrial biogenesis and function through PGC1B. J Endocrinol. 2017;232:297–308.
- Rodríguez-Cuenca S, Monjo M, Gianotti M, Proenza AM, Roca P. Expression of mitochondrial biogenesis-signaling factors in brown adipocytes is influenced specifically by 17β-estradiol, testosterone, and progesterone. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2007;292:E340–6.
- Barba-Moreno L, Cupeiro R, Romero-Parra N, Janse De Jonge XAK, Peinado AB. Cardiorespiratory Responses to Endurance Exercise Over the Menstrual Cycle and With Oral Contraceptive Use. J Strength Cond Res. 2022;36:392–9.
- Castro EA, Rael B, Romero-Parra N, Alfaro-Magallanes VM, Rojo-Tirado MA, García-de-Alcaraz A, et al. Influence of oral contraceptive phase on cardiorespiratory response to exercise in endurance-trained athletes. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2022;27:308–16.
- Lebrun CM, Petit MA, McKenzie DC, Taunton JE, Prior JC. Decreased maximal aerobic capacity with use of a triphasic oral contraceptive in highly active women: a randomised controlled trial. Br J Sports Med. 2003;37:315–20.
- Bryner RW, Toffle RC, Ullrich IH, Yeater RA. Effect of low dose oral contraceptives on exercise performance. Br J Sports Med. 1996;30:36–40.
- Vaiksaar S, Jürimäe J, Mäestu J, Purge P, Kalytka S, Shakhlina L, et al. No Effect of Menstrual Cycle Phase and Oral Contraceptive Use on Endurance Performance in Rowers. J Strength Cond Res. 2011;25:1571–8.
- Taylor MY, Osborne JO, Topranin VDM, Engseth TP, Solli GS, Valsdottir D, et al. Menstrual Cycle Phase Has No Influence on Performance-Determining Variables in Endurance-Trained Athletes: The FENDURA Project. Med Sci Sports Exerc. 2024;56:1595–605.
- Thompson B, Almarjawi A, Sculley D, Janse De Jonge X. The Effect of the Menstrual Cycle and Oral Contraceptives on Acute Responses and Chronic Adaptations to Resistance Training: A Systematic Review of the Literature. Sports Med. 2020;50:171–85.
- Oosthuyse T, Strauss JA, Hackney AC. Understanding the female athlete: molecular mechanisms underpinning menstrual phase differences in exercise metabolism. Eur J Appl Physiol. 2023;123:423–50.
- Bazgir B, Fathi R, Rezazadeh Valojerdi M, Mozdziak P, Asgari A. Satellite Cells Contribution to Exercise Mediated Muscle Hypertrophy and Repair. Cell J. 2017;18:473–84.
- Colenso-Semple LM, McKendry J, Lim C, Atherton PJ, Wilkinson DJ, Smith K, et al. Oral contraceptive pill phase does not influence muscle protein synthesis or myofibrillar proteolysis at rest or in response to resistance exercise. J Appl Physiol. 2025;138:810–5.
- Elliott-Sale KJ, Minahan CL, De Jonge XAKJ, Ackerman KE, Sipilä S, Constantini NW, et al. Methodological Considerations for Studies in Sport and Exercise Science with Women as Participants: A Working Guide for Standards of Practice for Research on Women. Sports Med. 2021;51:843–61.
- Elliott-Sale KJ, Altini M, Doyle-Baker P, Ferrer E, Flood TR, Harris R, et al. Why We Must Stop Assuming and Estimating Menstrual Cycle Phases in Laboratory and Field-Based Sport Related Research. Sports Med. 2025;Online ahead of print.
- Colenso‐Semple LM, McKendry J, Lim C, Atherton PJ, Wilkinson DJ, Smith K, et al. Menstrual cycle phase does not influence muscle protein synthesis or whole‐body myofibrillar proteolysis in response to resistance exercise. The Journal of Physiology. 2025;603:1109–21.
- Burgess KE, Pearson SJ, Onambélé GL. Patellar Tendon Properties With Fluctuating Menstrual Cycle Hormones. J Strength Cond Res. 2010;24:2088–95.
- Hansen M, Couppe C, Hansen CSE, Skovgaard D, Kovanen V, Larsen JO, et al. Impact of oral contraceptive use and menstrual phases on patellar tendon morphology, biochemical composition, and biomechanical properties in female athletes. J Appl Physiol. 2013;114:998–1008.
- Kubo K, Miyamoto M, Tanaka S, Maki A, Tsunoda N, Kanehisa H. Muscle and Tendon Properties during Menstrual Cycle. Int J Sports Med. 2009;30:139–43.
- Martínez-Fortuny N, Alonso-Calvete A, Da Cuña-Carrera I, Abalo-Núñez R. Menstrual Cycle and Sport Injuries: A Systematic Review. Int J Environ Res Public Health. 2023;20:3264.
- Dam TV, Dalgaard LB, Sevdalis V, Bibby BM, Janse De Jonge X, Gravholt CH, et al. Muscle Performance during the Menstrual Cycle Correlates with Psychological Well-Being, but Not Fluctuations in Sex Hormones. Med Sci Sports Exerc. 2022;54:1678–89.
Autoren
ist Sportwissenschaftler mit Schwerpunkt Leistungsphysiologie und Postdoktorant an der Universität Caen, Frankreich. Er verfügt über langjährige Berufserfahrung als Trainingswissenschaftler und Trainer im Hochleistungssport.
(Stand 2025)
ist Diplom-Sportwissenschaftler (TU München), Trainingswissenschaftler und
Athletiktrainer am Olympiastützpunkt Brandenburg, Potsdam. Er verfügt über Expertise in Beanspruchungsregulation, Energiestoffwechsel bei Kurzzeitbelastungen sowie Kraft- und Athletiktraining.
(Stand 2025)
ist Sportwissenschaftler und Professor für Trainingswissenschaft an der IST-Hochschule Düsseldorf. Research Fellow des European College of Sport Science sowie A-Trainer des Deutschen Tennis Bundes.
(Stand 2025)