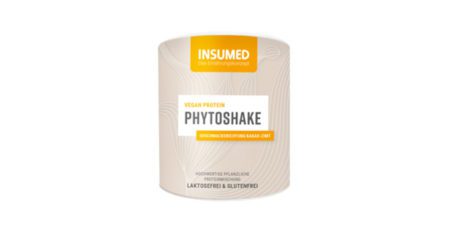Sowohl in Deutschland, als auch in den USA haben Leistungssportler niedrige Spiegel der omega-3 Fettsäuren Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA) in Erythrozyten, gemessen mit der Methode „HS-Omega-3 Index®“ [1, 2]. Diese Spiegel korrelieren mit Spiegeln von EPA und DHA in allen anderen Zellen, die man bisher untersucht hat, und sind eng mit klinisch relevanten Endpunkten verbunden [z. B. 3 – 5].
Im Gegensatz dazu ist der Zusammenhang zwischen zugeführten Mengen und Spiegeln von EPA und DHA nur lose, wie auch zwischen Zufuhr und klinischen Ereignissen, was im Design der meisten Interventionsstudien bisher ignoriert wurde [z. B. 6, 7]. Deshalb fokussiert die vorliegende Übersichtsarbeit auf neuere Daten, die auf der standardisierten Biomarker-Analytik „HS-Omega-3 Index“ beruhen [8-10]. Eine ausführlichere Fassung der vorliegenden Arbeit kann beim Autor angefordert werden.
Wirkungen beim Sportler – Beispiele Muskel, Herz und Gelenke
Muskel: In mehreren Interventionsstudien wurde durch die Gabe von omega-3 Fettsäuren vor einer Belastung, die geeignet war Muskelkater zu verursachen, dieser Muskelkater minimiert oder verhindert [Übersicht in 11], zusätzlich [12 – 17]. Entsprechende Messungen zeigten, dass nicht nur der initiale Anstieg der CK im Serum, sondern auch der typische Anstieg inflammatorischer Cytokine und die Schwellung des Muskels ausblieben bzw. minimiert wurden, sondern auch der Kraftverlust, der typischerweise mit dem Muskelkater verbunden ist [11 – 17]. Entscheidend für die klinische Wirksamkeit war der Omega-3 Index [18]. Daten von britischen Fußballspielern waren jüngst ähnlich [19]. Der Effekt einer Einzeldosis unmittelbar nach Belastung war ebenfalls erkennbar [20]. Ob auch Trainingsbedingter Muskelaufbau durch omega-3 Fettsäuren unterstützt wird, ist unklar [21]. In Studien zum Immobilisations-bedingten Muskelabbau fand man zu Muskelstruktur und -funktion ebenfalls keine klaren Ergebnisse [22, 23]. Allerdings wird der bislang als „altersbedingt“ betrachtete Verlust der Muskelfunktion durch omega-3 Fettsäuren mehr als ausgeglichen [24]. In einer methodisch adäquaten Interventionsstudie wurde der Sauerstoffverbrauch der Muskulatur bei intensiver Belastung durch die achtwöchige Gabe von omega-3 Fettsäuren, mit konsekutivem Anstieg des Omega-3 Index, ökonomisiert [25]. Leistungsparameter blieben unverändert, was zu Ergebnissen ähnlicher Interventionsstudien passt [25 – 27]. Der ökonomisierte Sauerstoffverbrauch der Muskulatur passt zu einem verlängerten anaeroben Durchhaltevermögen nach EPA und DHA [26]. Zusammenfassend bedeutet ein hoher Omega-3 Index eine geringere Neigung zu Muskelkater sowie einen geringeren „altersbedingten“ Muskelabbau, und eine Ökonomisierung des Sauerstoffverbrauches der Skelettmuskulatur. Die Gabe von omega-3 Fettsäuren scheint keinen Einfluss auf Trainingsbedingten Muskelaufbau oder Immobilisations-bedingten Abbau zu haben.
Herz: Im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung haben Leistungssportler eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für den plötzlichen Herztod [28]. Die Wahrscheinlichkeit für den plötzlichen Herztod ist bei niedrigen Spiegeln von EPA und DHA in Erythrozyten 10 mal höher, als bei hohen Spiegeln [29, 30]. In einer Interventionsstudie an kardiovaskulären Patienten reduzierte die Gabe von omega-3 Fettsäuren den plötzlichen Herztod bei Patienten mit koronarer Herzerkrankung [31]. Methodische Schwächen der meisten großen anderen kardiologischen Interventionsstudien, die dies nicht reproduzieren konnten, sind anderweitig ausführlich diskutiert [32, 33]. Eine randomisierte Interventionsstudie zur Prävention des plötzlichen Herztodes bei Sportlern ist aus Studien-methodischen und finanziellen Gründen nicht zu erwarten.
Lunge / Bronchokonstriktion: Eine Belastungs- und Hyperpnoe-induzierte Bronchienverengung, die 50% der Elite-Athleten betrifft, wurde durch eine erhöhte Zufuhr von EPA und DHA in mehreren Interventionsstudien gebessert [34]. Die Ergebnisse der Interventionsstudien waren nicht konsistent, weshalb die entsprechenden Leitlinien sich nicht positiv äußern [35]. Mängel im Studiendesign dürften für die Inkonsistenz der Ergebnisse verantwortlich sein. In einer 12-wöchigen Interventionsstudie an trainierenden Athleten, verbesserten omega-3 Fettsäuren FEV1, FVC, VC, MVV, FEF25-75, FIV1, während FEV1% und FIV1% unverändert blieben [36]. Zusammenfassend sind die Effekte von EPA und DHA auf die pulmonale Funktion nachweisbar, aber geringer als z.B. Effekte von entsprechenden Pharmaka.
Gelenke: Die anti-inflammatorischen Effekte von EPA und DHA dürften für die klaren Verbesserungen von Schmerz und anderen Symptomen bei Patienten mit rheumatoider Arthritis verantwortlich sein, die in Meta-Analysen entsprechender Interventionsstudien gesehen wurden [37]. Bei anderen Gelenkbeschwerden waren die Ergebnisse der Meta-Analyse weniger klar [37]; möglicherweise spielen auch hier die bereits angesprochenen Studien-methodischen Aspekte eine Rolle. Besser untersucht sind arthrotische und arthritische Beschwerden bei Hund und Katze: bei beiden Tieren bessern EPA und DHA Schmerz und Beweglichkeit, was, wenn untersucht, von den erreichten Spiegeln in den Erythrozyten abhing [38, 39]. Beim Menschen scheinen hohe Spiegel von EPA und DHA den Heilungsverlauf, z. B. nach Knieoperation, zu beschleunigen, was aber bisher nicht systematisch untersucht wurde. Diese positive Ausgangslage sollte in Interventionsstudien an Sportlern systematisch bearbeitet werden.
Majore Depression
Leistungssportler haben im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung eine erhöhte Wahr-
scheinlichkeit für majore Depression und Selbstmord [40, 41]. Je höher die Spiegel von EPA und DHA in Erythrozyten, desto geringer die Wahrscheinlichkeiten für majore Depression und Selbstmord [42 – 44]. Mehrere Meta-Analysen und systematische Reviews entsprechender Interventionsstudien zeigten, dass EPA und DHA allein und zusätzlich zu einer konventionellen psychiatrischen Therapie wirksam in Prävention und Behandlung der majoren Depression sind [z. B. 45]. Ein hoher Anteil EPA erhöht die Wirksamkeit, was die anti-inflammatorischen Aspekte in der Wirkung unterstreicht [46]. Entsprechend beginnen Leitlinien EPA und DHA zur Behandlung der majoren Depression zu empfehlen [47]. Ob eine HS-Omega-3 Index gesteuerte anti-depressive Behandlung überlegen ist, muss noch geklärt werden. Obwohl eine Interventionsstudie an Sportlern fehlt, unterstützen die Daten die Verwendung von EPA und DHA bei Sportlern zu Prävention und Therapie einer majoren Depression.
Hirnschäden und kognitive Funktionen
Athleten in Sportarten wie American Football oder Fußball haben eine erhöhte Inzidenz an Hirntraumata, deren Folgen sich als strukturelle Schäden in der Magnetresonanztomographie und als Einschränkungen der Hirnleistungsfähigkeit fassen lassen [48, 49]. Aspekte der Hirnstruktur und komplexer Hirnfunktionen, wie Merkfähigkeit oder exekutive Funktion, korrelieren mit der Höhe der Spiegel von EPA und DHA in Erythrozyten [50]. Es fehlen bisher Interventionsstudien an Sportlern, in denen eine präventive oder therapeutische Wirkung von omega-3 Fettsäuren bei traumatischen Hirnschäden untersucht wurde. Allerdings zeigte eine vierwöchige Supplementation mit 3,5 g/Tag EPA + DHA bei Fußballerinnen der ersten spanischen Liga, dass Reaktionszeit, Treffsicherheit und Effizienz sich im Vergleich zu Placebo besserten [51]. Andere Studien laufen, in denen Beweglichkeit und Selbstständigkeit Älterer mit einer Erhöhung des Omega-3 Index erhalten werden sollen [z. B. 52]. Die Ergebnisse von Interventionsstudien zu kognitiven Funktionen wie exekutiver Funktion, Erinnerungsvermögen, abstraktem Denkvermögen und ähnlich komplexen Hirnleistungen hingegen waren positiv, allerdings nur mit Dosierungen über 800 mg DHA (nicht mit niedrigeren Dosierungen) [50]. Zusammenfassend weisen die Studienergebnisse darauf hin, dass insbesondere in Sportarten, die mit rezidivierenden, auch kleineren, Hirntraumata einhergehen, die kognitiven Funktionen von Sportlern in besonderer Weise von hohen Spiegeln von EPA und DHA profitieren würden [53].
Sicherheit und Verträglichkeit
Laut der European Food Safety Authority ist die Gabe von EPA und DHA 5 g / Tag sicher, während die US-amerikanische Food and Drug Administration 3 g / Tag als sicher betrachtet [9,54]. In den meisten großen Interventionsstudien waren Sicherheit, Verträglichkeit und Tolerabilität von EPA und DHA auf dem Niveau von Placebo [9,54]. Eine vermehrte Blutungsneigung in Abhängigkeit von der Höhe des HS-Omega-3 Index wurde weder akut bei der Behandlung eines Herzinfarktes, noch in Langzeitstudien an europäischen antikoagulierten Patienten, noch bei Patienten mit Thrombozytenaggregationshemmern gesehen [9,54,55,56]. Eine Ausnahme war JELIS, eine 4,6 Jahre lange randomisierte Interventionsstudie an >18 000 Hyperlipidämikern in Japan, in der in der Placebogruppe bei 0,6% und in der Verumgruppe (1,8 g EPA / Tag) bei 1,1% der Teilnehmer eine Blutung beobachtet wurde [57]. Der mittlere HS-Omega-3 Index liegt in Japan bei 10%, und dürfte durch die Intervention im Mittel deutlich über den Zielbereich von 8 – 11% angehoben worden sein [58]. Deshalb empfiehlt sich 3 – 4 Monate nach Beginn einer Supplementation mit EPA und DHA, d.h. nachdem eine neue Population Erythrozyten gebildet wurde, eine Kontrolle des HS-Omega-3 Index, und ggf. eine Dosisreduktion.
Eine erhöhte Zufuhr von EPA und DHA könnte theoretisch vermehrt zu oxidativen Prozessen führen, die theoretisch die anti-oxidativen Mechanismen des Menschen überfordern würden. Messungen von F(2)-Isoprostanen, die, im Gegensatz z.B. zu ox-LDL oder TBARS, als verlässlich gelten, belegen das Gegenteil: Erhöhte Zufuhr von EPA und/oder DHA vermindert die Lipid-Peroxidation [59]. Bei Sportlern und am Muskel wurden verschiedene anti-oxidative Mechanismen verbessert [60-62].
Zusammenfassend muss das Erreichen eine HS-Omega-3 Index von 8 – 11 % durch erhöhte Zufuhr von EPA und DHA mit einer täglichen Dosis bis zu 3 – 5 g als sicher und verträglich gelten. Daher kann eine Abwägung von Nutzen und Risiko vor Erhöhung der Zufuhr entfallen, was die Entscheidung zur Gabe von EPA und DHA erleichtert.
Bioverfügbarkeit
Bei vielen Interventionsstudien wurden Aspekte der Bioverfügbarkeit missachtet. Werden – wie in diesen Interventionsstudien – EPA und DHA in Kapseln ohne begleitende oder zu einer fettarmen Mahlzeit eingenommen, dann wird die Fettverdauung mit Stimulation des Gallenflusses und der Bauchspeicheldrüse nicht aktiviert. Werden EPA und DHA als Kapseln hingegen zu einer fettreichen Mahlzeit oder zur Hauptmahlzeit genommen, oder im Fisch verzehrt, so ist die Fettverdauung aktiviert, und so die Bioverfügbarkeit maximiert [64]. Dann reichen Dosierungen bis maximal 5 g/ Tag in der Regel mehr als aus, um den HS-Omega-3 Index in den Zielbereich von 8 – 11 % zu heben. Neben freien Fettsäuren, bei denen die Bioverfügbarkeit nicht von einer Mahlzeit abhängt, werden für die Supplementation in den nächsten Jahren Emulsionen zur Verfügung stehen, die auch ohne begleitende Mahlzeit eine hohe Bioverfügbarkeit haben [7, 64].
Quellen von EPA und DHA
Reich an EPA und DHA sind Lachs, Makrele, Thunfisch und andere Fische aus kalten Meeren. Allerdings muss von häufigem Verzehr von Thunfisch abgeraten werden, da Thunfisch – wie alle langlebigen Raubfische – Methylquecksilber und organische Toxine anreichert. Bei der Fischzucht in Aquakultur hat man über die letzten Jahre die Verwendung von EPA und DHA im Futter verringert, weshalb diese Fische abnehmende Mengen EPA und DHA enthalten. Fische aus Wildfang hingegen bewegen sich mehr, und enthalten insgesamt weniger Fett. Will man die Dosis EPA und DHA wissen, so bleibt die Supplementation. Verschiedene Produkte werden angeboten, wobei konzentriertere Produkte in der Regel einen höheren Preis haben. Im Rahmen der Herstellung werden Kontaminanten und Toxine entfernt. Produkte aus Algen haben einen höheren Preis, sind aber für Vegetarier oder Veganer geeignet.
Diskussion
Unklar ist, warum Athleten im Mittel besonders niedrige HS-Omega-3 Indexe haben. Da weder EPA noch DHA in nennenswerten Mengen im Körper synthetisiert werden können, auch nicht von der theoretischen Vorläufer-Fettsäure alpha-Linolensäure, hängen die Spiegel von EPA und DHA in besonderer Weise von der Zufuhr ab. Möglich, aber noch nicht nachgewiesen, ist auch ein ausgeprägter Katabolismus aufgrund des hohen Energiestoffwechsels von Athleten. Ein Omega-3 Index im Zielbereich hat, wie oben geschildert, positive Auswirkungen auf die kardiovaskuläre Leistungsfähigkeit, die aber insgesamt nicht sehr ausgeprägt sind. Dazu kommen die geschilderten anti-arrhythmischen Effekte sowie ein normalisiertes Blutdruckverhalten. Diese Effekte sind geringer als die von entsprechenden Pharmaka, was ein wesentlicher Grund dafür sein dürfte, dass omega-3 Fettsäuren nicht auf der aktuellen Liste verbotener Substanzen der Welt Anti-Doping Agentur finden [48].
Weil für Sportler weniger relevant, sind hier die positiven Effekte der Erhöhung der Spiegel von EPA und DHA in Erythrozyten hinsichtlich einer Lebensverlängerung, Vermeidung kognitiver Einschränkungen im Alter, der Behandlung einer Herzinsuffizienz, während und nach einer Schwangerschaft, Autismus, Aufmerksamkeits-Defizit-hyperkinetischem Syndrom (ADHS), Besserung der nicht-alkoholischen Fettleber, der Reaktion auf Feinstaub, und bei weiteren Problemen nicht ausgeführt. In der Regel sind die genannten Zustände durch niedrige Spiegel von EPA und DHA in Erythrozyten charakterisiert, wobei Parameter der Besserung in der Regel mit dem Anstieg von EPA und DHA in Erythrozyten korrelieren.
Die Häufigkeit der in dieser Übersicht genannten Zustände wirft die Frage auf, ob in unserer Bevölkerung ein Defizit an EPA und DHA bestehen könnte. Dieses Defizit könnte durch eine Reduktion der Zufuhr von EPA und DHA verursacht worden sein, wie sie in den letzten Jahren zu beobachten war. Gründe sind der Verzicht auf Quellen von EPA und DHA (z. B. aus guten Gründen Rinderhirn), abnehmende Fütterung mit EPA und DHA und so abnehmender Gehalt von Fischen in Aquakultur, und möglicherweise die große Zunahme des Verzehrs von omega-6 Fettsäuren seit der Industrialisierung der Landwirtschaft. Dieses Defizit ist vor allem in westlichen Ländern zu beobachten, und hat teilweise dramatische Ausmaße [49]. Im Vergleich mit den meisten bisher untersuchten Populationen in Deutschland liegen allerdings die von uns untersuchten Sportler noch niedriger [1, 50, 51]. Statistische Bundesämter haben begonnen, mit der Methode des HS-Omega-3 Index repräsentativ Bevölkerungen zu untersuchen und z. B. in Kanada bedenklich niedrige Spiegel gefunden [52]. Interventionsstudien zum „altersabhängigen“ Abbau von Muskel und Gehirn können nur vor dem Hintergrund eines Defizits positiv sein – „Altern“ ist derzeit in westlichen Ländern also teilweise bedingt durch das Defizit an EPA und DHA [z. B. 24, 53]. Das Defizit an EPA und DHA ist ein wesentliches Gesundheitsproblem, das nur durch eine Bestimmung des HS-Omega-3 Index erkannt werden kann.
Fazit
Die mittleren HS-Omega-3 Indexe liegen bei Sportlern weit unter dem Zielbereich von 8 – 11 %. Neben einer eingeschränkten Lebenserwartung, auch bedingt durch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit des plötzlichen Herztodes, bedeutet dies eine suboptimale Funktion von Herz-Kreislaufsystem, Muskel, Gehirn und weiteren Organen, auf die der Sportler in besonderer Weise angewiesen ist oder die der Sportler in besonderer Weise belastet. Eine Erhöhung des HS-Omega-3 Index in den Zielbereich durch erhöhte Zufuhr von EPA und DHA ist bis 5 g/Tag sicher und verträglich; unerwünschte Wirkungen waren in Interventionsstudien in Häufigkeit und Schwere mit Placebo vergleichbar. Wird der Zielbereich deutlich überschritten, so können selten Blutungsereignisse beobachtet werden, weshalb der HS-Omega-3 Index 3 – 4 Monate nach Erhöhung der Zufuhr von EPA und DHA kontrolliert werden sollte, und ggf. die Dosis angepasst werden sollte. Parameter der kardio-
pulmonalen Leistungsfähigkeit werden durch die Optimierung des HS-Omega-3 Index sicher nicht verschlechtert, in einzelnen Studien sogar verbessert. Neben anderen positiven Aspekten bedeutet ein HS-Omega-3 Index im Zielbereich, dass durch eine sichere und verträgliche Erhöhung der Zufuhr von EPA und DHA schwerwiegenden Erkrankungen wie plötzlicher Herztod oder majore Depression vorgebeugt wird, Muskelarbeit und Aspekte der Kognition optimiert werden, und „Altern“ von Muskeln und Hirn verlangsamt wird.
Literatur
[1] von Schacky C, Haslbauer R, Kemper M, Halle M. Low Omega-3 Index in 106 German elite winter endurance Athletes – A pilot study. International Journal of Sport Nutrition & Exercise Metabolism 2014;24:559 – 64
[2] Wilson PB, Madrigal LA. Associations Between Whole Blood and Dietary Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acid Levels in Collegiate Athletes. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2016;26:497 – 505
[3] Kleber ME, Delgado GE, Lorkowski S, März W, von Schacky C. Omega-3 fatty acids and mortality in patients referred for coronary angiography – The Ludwigshafen Risk and Cardiovascular Health Study. Atherosclerosis 2016;252:157 – 81
[4] Heydari B, Abdullah S, Pottala JV, et al. Effect of Omega-3 Acid Ethyl Esters on Left Ventricular Remodeling After Acute Myocardial Infarction: The OMEGA-REMODEL
Randomized Clinical Trial. Circulation. 2016;134:378 – 91
[5] Harris WS, del Gobbo L, Tintle NL. The Omega-3 Index and relative risk for coronary heart disease mortality: Estimation from 10 cohort studies. Atherosclerosis 2017;
262:51 – 4
[6] Schuchardt JP, Hahn A. Bioavailability of long-chain omega-3 fatty acids. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2013;89:1 – 8
[7] Köhler A, Heinrich J, von Schacky C. Bioavailability of dietary omega-3 fatty acids in a variety of sausages in healthy individuals. Nutrients 2017;9:629
- Harris WS and von Schacky C. The Omega-3 Index: A New Risk Factor for Death from CHD? Preventive Medicine 2004;39:212-20
- von Schacky C. Omega-3 Fettsäuren und Major Depression. Vitalstoffe 2017;3:28-33
- von Schacky C. Omega-3 Fettsäuren im Sport. Vitalstoffe 2015;5/4:10-6
- Kim J, Lee J. A review of nutritional intervention on delayed onset muscle soreness. Part I. J Exerc Rehabil. 2014;10:349-56
- Mickleborough TD, Sinex JA, Platt D, Chapman RF, Hirt M. The effects PCSO-524®, a patented marine oil lipid and omega-3 PUFA blend derived from the New Zealand green lipped mussel (Perna canaliculus), on indirect markers of muscle damage and inflammation after muscle damaging exercise in untrained men: a randomized, placebo controlled trial. J Int Soc Sports Nutr. 2015;12:10.
- DiLorenzo FM, Drager CJ, Rankin JW. Docosahexaenoic acid affects markers of inflammation and muscle damage after eccentric exercise. J Strength Cond Res. 2014;28:2768-74
14. Tsuchiya Y, Yanagimoto K, Nakazato K, Hayamizu K, Ochi E. Eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids-rich fish oil supplementation attenuates strength loss and limited joint range of motion after eccentric contractions: a randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group trial. Eur J Appl Physiol. 2016;116:1179-88
- Corder KE, Newsham KR, McDaniel JL, Ezekiel UR, Weiss EP. Effects of Short-Term Docosahexaenoic Acid Supplementation on Markers of Inflammation after Eccentric Strength Exercise in Women. J Sports Sci Med. 2016;15:176-83
- Tinsley GM, Gann JJ, Huber SR, et al. Effects of Fish Oil Supplementation on Postresistance Exercise Muscle Soreness. J Diet Suppl. 2016;21:1-12
- Lewis EJ, Radonic PW, Wolever TM, Wells GD. 21 days of mammalian omega-3 fatty acid supplementation improves aspects of neuromuscular function and performance in male athletes compared to olive oil placebo. J Int Soc Sports Nutr. 2015;12:28
- Lembke P, Capodice J, Hebert K, Swenson T. Influence of omega-3 (n3) index on performance and wellbeing in young adults after heavy eccentric exercise. J Sports Sci Med. 2014;13:151-6
- Philpott JD, Donnelly C, Walshe IH, et al. Adding Fish Oil to Whey Protein, Leucine and Carbohydrate Over a 6 Week Supplementation Period Attenuates Muscle Soreness Following Eccentric Exercise in Competitive Soccer Players. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2017 Sep 5:1-28.
- Jakeman JR, Lambrick DM, Wooley B, Babraj JA, Faulkner JA. Effect of an acute dose of omega-3 fish oil following exercise-induced muscle damage. Eur J Appl Physiol. 2017;117:575-82.
- Da Boit M, Sibson R, Sivasubramaniam S, et al. Sex differences in the effect of fish-oil supplementation on the adaptive response to resistance exercise training in older people: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 2017;105:151-8.
- Bostock EL, Morse CI, Winwood K, McEwan IM, Onambélé GL. Omega-3 Fatty Acids and Vitamin D in Immobilisation: Part A- Modulation of Appendicular Mass Content, Composition and Structure. J Nutr Health Aging. 2017;21:51-8.
- Bostock EL, Morse CI, Winwood K, McEwan IM, Onambélé GL. Omega-3 Fatty Acids and Vitamin D in Immobilisation: Part B- Modulation of Muscle Functional, Vascular and Activation Profiles. J Nutr Health Aging. 2017;21:59-66.
- Smith GI. The Effects of Dietary Omega-3s on Muscle Composition and Quality in Older Adults. Curr Nutr Rep. 2016;5:99-105
- Hingley L, Macartney MJ, Brown MA, McLennan PL, Peoples GE. DHA-rich Fish Oil Increases the Omega-3 Index and Lowers the Oxygen Cost of Physiologically Stressful Cycling in Trained Individuals. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2017;27:335-43.
26. Gravina L, Brown FF, Alexander L, Dick J, Bell G, Witard OC, Galloway SDR. n-3 Fatty Acid Supplementation During 4 Weeks of Training Leads to Improved Anaerobic Endurance Capacity, but not Maximal Strength, Speed, or Power in Soccer Players. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2017;27:305-13.
- Da Boit M, Hunter AM, Gray SR. Fit with good fat? The role of n-3 polyunsaturated fatty acids on exercise performance. Metabolism. 2017;66:45-54.
- Chandra N, Bastiaenen R, Papadakis M, Sharma S. Sudden cardiac death in young athletes: practical challenges and diagnostic dilemmas. J Am Coll Card 2013;61:1027-40.
- Siscovick DS, Raghunathan TE, King I, et al Dietary intake and cell membrane levels of long-chain n-3 polyunsaturated fatty acids and the risk of primary cardiac arrest. J Am Med Assoc 1995;275:836-7
- Albert CM, Campos H, Stampfer MJ, et al. Blood levels of long-chain n-3 fatty acids and the risk of sudden death. N Engl J Med 2002;346:1113-8
- Marchioli R, Barzi F, Bomba E, et al; GISSI-Prevenzione Investigators. Early protection against sudden death by n-3 polyunsaturated fatty acids after myocardial infarction: time-course analysis of the results of the Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell’Infarto Miocardico (GISSI)-Prevenzione. Circulation. 2002;105:1897-903
- von Schacky C. Omega-3 Fatty Acids in Cardiovascular Disease – an Uphill Battle. PLEFA 2015;92:41-7
- Rice HB, Bernasconi A, Maki KC, Harris WS, von Schacky C, Calder PC. Conducting omega-3 clinical trials with cardiovascular outcomes: Proceedings of a workshop held at ISSFAL 2014. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2016;107:30-42
- Williams NC, Hunter KA, Shaw DE, Jackson KG, Sharpe GR, Johnson MA. Comparable reductions in hyperpnoea-induced bronchoconstriction and markers of airway inflammation after supplementation with 6·2 and 3·1 g/d of long-chain n-3 PUFA in adults with asthma. Br J Nutr. 2017;117:1379-89.
- Weiler JM, Brannan JD, Randolph CC, et al. Exercise-induced bronchoconstriction update-2016. J Allergy Clin Immunol. 2016;138:1292-5
- Tartibian B, Maleki BH, Abbasi A. The effects of omega-3 supplementation on pulmonary function of young wrestlers during intensive training. J Sci Med Sport. 2010;13:281-6
- Senftleber NK, Nielsen SM, Andersen JR, et al. Marine Oil Supplements for Arthritis Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Trials. Nutrients. 2017 6;9(1)
38. Mehler SJ, Maya LR, King C, Harris WS, Shah Z. A prospective, randomized, double blind, placebo-controlled evaluation of the effects of eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid on the clinical signs and erythrocyte membrane polyunsaturated fatty acid concentrations in dogs with osteoarthritis. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2016;109:1-7
- Boe C, Vangsness CT. Fish Oil and Osteoarthritis: Current Evidence. Am J Orthop (Belle Mead NJ). 2015;44:302-5.
- Hammond T, Gialloreto C, Kubas H, Davis HH 4th. The Prevalence of Failure-Based Depression Among Elite Athletes. Clin J Sport Med 2013;23:273-7.
- Webner D, Iverson GL. Suicide in professional American football players in the past 95 years. Brain Inj. 2016;30:1718-21
- Pottala JV, Churchill SW, Talley JA, Lynch DA, von Schacky C, Harris WS. Red Blood Cell Fatty Acids are Associated with Depression in a Case-Control Study of Adolescents. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2012;86:161-5
- Baghai TC, Varallo-Bedarida G, Born C, Häfner S, Schüle C, Eser D, Rupprecht R, Bondy B, von Schacky C. Major depression is associated with cardiovascular risk factors and low Omega-3 Index. J Clin Psychiat 2011;72:1242-7
- Hibbeln JR, Gow RV. The potential for military diets to reduce depression, suicide, and impulsive aggression: a review of current evidence for omega-3 and omega-6 fatty acids. Mil Med. 2014;179(11 Suppl):117-28.
- Sarris J, Murphy J, Mischoulon D, et al. Adjunctive Nutraceuticals for Depression: A Systematic Review and Meta-Analyses. Am J Psychiatry. 2016;173:575-87.
- Hallahan B, Ryan T, Hibbeln JR, et al. Efficacy of omega-3 highly unsaturated fatty acids in the treatment of depression. Br J Psychiatry. 2016;209:192-201
- Ravindran AV, Balneaves LG, Faulkner G, et al; CANMAT Depression Work Group. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) 2016 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder: Section 5. Complementary and Alternative Medicine Treatments. Can J Psychiatry. 2016;61:576-87.
- Coughlin JM, Wang Y, Minn I, et al. Imaging of Glial Cell Activation and White Matter Integrity in Brains of Active and Recently Retired National Football League Players. JAMA Neurol. 2017;74:67-74
- McAllister T, McCrea M. Long-Term Cognitive and Neuropsychiatric Consequences of Repetitive Concussion and Head-Impact Exposure. J Athl Train. 2017;52:309-317
- von Schacky C. w-3 Fettsäuren und Hirnfunktion. Orthomol Med 2016;2:6-10
- Guzmán JF, Esteve H, Pablos C, Pablos A, Blasco C, Villegas JA. DHA- Rich Fish Oil Improves Complex Reaction Time in Female Elite Soccer Players. J Sports Sci Med. 2011;10:301-5.
- Schättin A, de Bruin ED. Combining Exergame Training with Omega-3 Fatty Acid Supplementation: Protocol for a Randomized Controlled Study Assessing the Effect on Neuronal Structure/Function in the Elderly Brain. Front Aging Neurosci. 2016;8:283.
- Trojian TH, Wang DH, Leddy JJ. Nutritional Supplements for the Treatment and Prevention of Sports-Related Concussion-Evidence Still Lacking. Curr Sports Med Rep. 2017;16:247-55.
- von Schacky C. Omega-3 Fatty Acids in Cardiovascular Disease – an Uphill Battle. PLEFA 2015;92:41-7
- Salisbury AC, Harris WS, Amin AP, Reid KJ, O’Keefe Jr JH, Spertus JA. Relation Between Red Blood Cell Omega-3 Fatty Acid Index and Bleeding During Acute Myocardial Infarction. Am J Cardiol. 2012;109:13-8
- Reiner MF, Simona Stivala S, Limacher A, et al. Omega-3 Fatty Acids Predict Recurrent Venous Thromboembolism or Total Mortality in Elderly Patients with Acute Venous Thromboembolism. J Thromb Haemostas 2017;17:47-56
- Yokoyama M, Origasa H, Matsuzaki M, et al; Japan EPA lipid intervention study (JELIS) Investigators. Effects of eicosapentaenoic acid on major coronary events in hypercholesterolaemic patients (JELIS): a randomised open-label, blinded endpoint analysis. Lancet. 2007;369(9567):1090-8
- Harris WS, von Schacky C, Park Y. Standardizing Methods for Assessing Omega-3 Fatty Acid Biostatus. In The Omega-3 Fatty Acid Deficiency Syndrome; McNamara RK ed., Nova Science Publishers 2013
- Mori TA. Effect of fish and fish oil-derived omega-3 fatty acids on lipid oxidation. Redox Rep. 2004;9:193-7.
- Martorell M, Capó X, Bibiloni MM, et al. Docosahexaenoic acid supplementation promotes erythrocyte antioxidant defense and reduces protein nitrosative damage in male athletes. Lipids. 2015;50:131-48.
- Capó X, Martorell M, Sureda A, Llompart I, Tur JA, Pons A. Diet supplementation with DHA-enriched food in football players during training season enhances the mitochondrial antioxidant capabilities in blood mononuclear cells. Eur J Nutr. 2015;54:35-49
- Herbst EA, Paglialunga S, Gerling C, et al. Omega-3 supplementation alters mitochondrial membrane composition and respiration kinetics in human skeletal muscle. J Physiol. 2014;592:1341-52.
- Schuchardt JP, Hahn A. Bioavailability of long-chain omega-3 fatty acids. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2013;89:1-8.
- Köhler A, Bittner D, Löw A, von Schacky C. Effects of a convenience drink fortified with n-3 fatty acids on the n-3 index. Br J Nutr 2010;104:729-36.
- https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2016-09-29_-_wada_prohibited_list_2017_eng_final.pdf, aufgerufen am 20.11.17
- Stark KD, Van Elswyk ME, Higgins MR, Weatherford CA, Salem N Jr. Global survey of the omega-3 fatty acids, docosahexaenoic acid and eicosapentaenoic acid in the blood stream of healthy adults. Prog Lipid Res. 2016;63:132-52
- Gellert S, Schuchardt JP, Hahn A. Higher Omega-3 Index and DHA status in pregnant women compared to lactating women – Results from a German nation-wide cross-sectional study. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2016;109:22-28
- Gellert S, Schuchardt JP, Hahn A. Low long chain omega-3 status in middle-aged women. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2017;117:54-5
- Langlois K, Ratnayake WMN. Omega-3 Index of Canadian Adults. Statistics Canada, Catalogue No. 82-003-X. Health Reports 2015;26:3-11
- Witte AV, Kerti L, Hermannstädter HM, et al. Long-chain omega-3 fatty acids improve brain function and structure in older adults. Cereb Cortex. 2014;24:3059-68
Autoren
ist Internist, Kardiologe und Angiologe. Er leitet die Präventive Kardiologie der Universität München und das Labor Omegametrix in Martinsried. Er gilt als wesentlicher Experte zu Omega-3 Fettsäuren und hat gemeinsam mit WS Harris, USA, eine Fettsäureanalytik erfunden und definiert, die Grundlage für unzählige Forschungsarbeiten war und ist und nun Eingang in die klinische Routine findet.