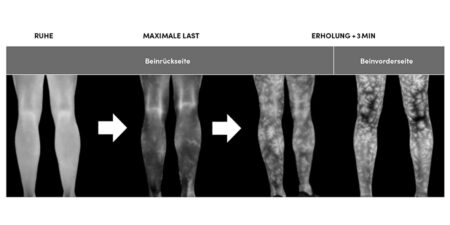Spätestens mit der erstmaligen Austragung Olympischer Kletter-Wettkämpfe hat die Sportart weltweite Aufmerksamkeit und Anerkennung erhalten. Leistungssportler trainieren heutzutage sowohl an echtem Fels als auch an künstlichen Wänden; Kletterwettbewerbe werden jedoch fast ausschließlich an künstlichen Wänden ausgetragen [1].
Im Vergleich zum Klettern am Fels ermöglicht das Klettern an künstlichen Wänden mehr akrobatische Bewegungen und hat zur Entwicklung verschiedener Kletterdisziplinen beigetragen [1]. Drei verschiedene Teildisziplinen werden heute als Wettkampfformen ausgetragen: 1) Vorstieg (auch „Lead“, Klettern mit Seilsicherung), 2) Bouldern (Klettern in geringer Höhe mit Mattenschutz) und 3) Speed (Klettern mit maximaler Geschwindigkeit auf einer standardisierten Route im 1-on-1-Modus mit Seilsicherung). Ursprünglich als Trainingsform für das Vorstiegsklettern eingeführt, wurde das Bouldern erst deutlich später als eigenständige Disziplin etabliert [1]. Das Format hat jedoch in den letzten zehn Jahren massiv an Popularität gewonnen und ist für den größten Teil des weltweiten rasanten Aufstiegs des gesamten Klettersports verantwortlich. Die Teildisziplinen Vorstieg und Bouldern erfordern ähnliche körperliche Fähigkeiten (insb. Oberkörperkraft), während Speed insbesondere Explosivkraft der unteren Extremitäten erfordert [1]. Der olympische Wettkampfmodus in Tokio wurde als „Combined“ ausgetragen, bei dem die Sieger aus den Teilergebnissen aller drei Teildisziplinen ermittelt wurden. Hintergrund hierfür war die Entscheidung des Weltkletterverbandes (IFSC), alle drei Disziplinen präsentieren zu wollen. Der neue Modus stellte jedoch eine Herausforderung für die Athleten dar, da diese Bestleistungen in allen Disziplinen unter Beweis stellen mussten. Die Teilnahme an allen drei Disziplinen war zuvor eine Rarität und Athleten traten entweder im Lead/Bouldern oder im Speed an [1].
Olympische Kletterwettkämpfe
Bei den Olympischen Spielen in Tokio wurden erstmals überhaupt Wettbewerbe im Sportklettern ausgetragen. Als Dreikampf ausgelegt wurden nach drei Einzelwettbewerben (Lead, Bouldern, Speed) der Männer und Frauen (3. bis zum 6. August 2021) je ein Olympiasieger gekürt. Nach einer Qualifikationsrunde erreichten dabei je acht Sportler die Finalrunde. Bedingt durch die stark limitierte Teilnehmerzahl bei der erstmaligen Austragung der Kletterwettkämpfe durften pro Geschlecht je 20 Athleten starten (max. zwei aus einer Nation). Aus den Reihen des deutschen Nationalkaders waren die beiden Routiniers Jan Hoyer und Alexander Megos qualifiziert. Die beiden reisten gemeinsam mit dem Bundestrainer Urs Stöcker, dem Team-Physiotherapeuten Martin Schlageter sowie einem Vertreter des DAV nach Tokio. Die Olympia Premiere verlief spektakulär, erreichte weltweit hohe Einschaltquoten und Janja Garnbgret (Slovenien) sowie Alberto Ginés López (Spanien) konnten sich als erste Olympiasieger in die Geschichtsbücher eintragen. Die beiden deutschen Athleten erreichten leider nicht die Finalrunde; Alexander Megos verpasste mit Platz 9 in der Qualifikation diese nur knapp.
Für Aufsehen und Diskussionen sorgte eine schwere Verletzung des Franzosen Bassa Mawem. Der eigentlich als Speed-Spezialist bekannte Athlet erlitt bei einem Zug im Lead-Wettkampf einen Riss der linken Bizepssehne und wurde wenige Tage später in Frankreich operiert. Diese Verletzung ist bei jungen Klettersport-Athleten eine Rarität. Bereits seit Bekanntwerden des Olympischen Wettkampfformates (Combined) wurde mehrfach auf das Verletzungsrisiko der spezialisierten Athleten in den für sie ungewohnten Disziplinen hingewiesen [2]. Für die kommenden Olympischen Spiele in Paris ist nun eine Änderung des Wettkampfformates geplant, mit separater Austragung eines Lead/Boulder- sowie eines Speed Wettbewerbs. Aus sportlicher wie auch medizinischer Sicht eine sinnvolle Entscheidung.
Prävention im Spitzensport
Die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Verletzungsprävention im Spitzensport ist bisher nur wenig erforscht [3]. Die nachfolgenden Empfehlungen basieren daher überwiegend auf Expertenmeinungen oder Erfahrungen aus Fallserien, die meist nur einen geringen Evidenzgrad aufweisen [3].
Allgemeine und spezifische Präventivmaßnahmen
Mehrere Studien zu neuromuskulären Trainingsprogrammen konnten deren präventive Wirksamkeit im Klettersport noch nicht eindeutig nachweisen [3]. Gronert et al. zeigten jedoch unlängst in ihrer Analyse eines vierwöchigen Rehabilitationsprogramms (so genanntes „Adjunct Compensatory Training“, ACT), dass dieses bei Kletterern mit Überlastungsbeschwerden der Schulter zu einer Verbesserung der Schmerzsituation, der Alltagsbeeinträchtigungen, des Bewegungsausmaßes und der Kraft führt. Die Autoren gehen davon aus, dass das regelmäßig durchgeführte Training die Schulterbeschwerden auch auf lange Sicht verbessert und das Programm zugleich präventiv wirken kann [4]. Für einige weitere sportartspezifische Präventionskonzepte, deren Wirksamkeit objektiv unbestritten ist, gibt es noch immer wenig Evidenz [3]. Dazu gehören ein ausreichender Bodenschutz (Matten) mit geschlossenen Nahtverbindungen beim Bouldern, dynamische Sicherungstechnik (Seilsicherungstechnik) beim Lead und ein angepasster Routenbau. Andere spezifische Maßnahmen, wie das Taping der Finger, wurden detaillierter untersucht [3]. Josephsen et al. zeigten in ihrer Arbeit mit 152 Athleten, dass sich das präventive Taping bei Fingerverletzungen als nicht präventiv erwies (keine Unterscheidung zwischen akuten oder Überlastungsschäden) [4]. Woollings et al. zeigten in ihrer Querschnittsstudie an n=116 Athleten, dass Kletterer, die ein rein präventives Fingertape anlegten, sogar ein erhöhtes Risiko für Fingerverletzungen aufwiesen [5]. Die Wahrscheinlichkeit, sich zu verletzen, war bei denjenigen, die das präventive Taping anwandten, mehr als fünfmal so hoch (95 % CI 1,4 bis 18,0) als bei Athleten ohne Tape [5]. Hingegen ist der positive Einfluss auf die Reduktion von Re-Verletzungen durch Tapen in mehreren Studien nachgewiesen worden, insbesondere nach Ringbandverletzungen [5]. Neben Verletzungen an den Fingern leiden Kletterer mitunter an Verletzungen oder Überlastungsschäden im Bereich der Füße; Beschwerden im Bereich der Zehen wurden dabei mit bis zu 65 % aller Fußverletzungen beschrieben [6]. Die Mehrzahl der Fußverletzungen resultiert dabei aus dem Tragen von zu kleinen Schuhen, einem Faktor, der leicht behoben werden kann. In diesem Zusammenhang analysierte Van der Putten Fußverletzungen in Verbindung mit dem Design eines neuen Kletterschuhs, der sich der natürlichen Form des Fußes anpasst, und stellte fest, dass eine verbesserte Schuhpassform, ein optimierter Sohlengummi, angepasste Verschlusssysteme und andere Faktoren Fußverletzungen reduzieren können [7].
Trainings- und Wettkampfmodifikationen
In einer prospektiven Analyse der deutschen Junioren-Nationalmannschaft (im Vergleich zu einer Gruppe von Freizeitkletterern) konnten wir in den vergangenen Jahren zeigen, dass folgende Faktoren signifikant zu einer frühzeitigen Entstehung einer Arthrose der Fingergelenke beitragen: Gesamtzahl der Trainingsjahre, Einsatz von Campus-Board-Training und ein hohes Kletterniveau [8]. Für jüngere Athleten ist eine Anpassung der Trainings- und Wettkampfformate besonders wichtig. Obwohl es keine großen prospektiven Vergleichsstudien zur Risikobewertung spezifischer Kletterdisziplinen oder Fingertrainingsmethoden im Jugendalter gibt, heben eine Vielzahl von Fallberichten und Serien das Risiko von Wachstumsfugenverletzungen durch die enorme Belastung hervor. Bis zu 50 % der epiphysären Frakturen treten beim Bouldern auf [9]. Um die Gesamtbelastung der Finger jugendlicher Athleten zu verringern, wurden Boulderwettkämpfe jugendlicher Athleten (<16. LJ) limitiert. Dies stützt sich auf die Tatsache, dass hohe Belastungen der Finger von Jugendlichen vor allem bei wiederholten schweren Kletterzügen beim Bouldern auftreten. Mit der weiteren Professionalisierung des Klettersportes, wurde diese Einschränkung bereits wieder aufgehoben [10]. Eine genaue Beobachtung der Fingerwachstumsfugen bei jugendlichen Kletterern ist daher essentiell. Ein intensives isoliertes Fingerkrafttraining, insbesondere mit Zusatzgewichten, ist bei jugendlichen Sportlern aus den oben genannten Gründen strikt zu meiden [10].
Zusammenfassen kann daher empfohlen werden:
- Ausreichender Bodenschutz (Matten) mit geschlossenen Verbindungen beim Bouldern
- Dynamische Sicherungstechnik (Seilsicherungstechnik) beim Vorstiegsklettern
- Angemessene Größe der Kletterschuhe (Vermeidung von zu kleinen Schuhen)
- Sicherheitsanforderungen beim Routenbau (Positionierung von Griffen und Sicherungspunkten)
- Limitierung von spezifischen Trainingsprogramme mit intensiver Fingerbelastung (insbesondere Campus-Board-Training)
- Ein geschlechtsspezifisches und altersgerechtes Training unter Vermeidung eines intensiven fingerspezifischen Trainings bei jungen Sportlern vor dem Abschluss des Längenwachstums
- Vermeidung von präventivem Fingertape; Fingertaping nach Verletzungen wird jedoch empfohlen.
Körpergewicht
Der Erfolg beim Klettern erfordert ein optimales Verhältnis von Kraft- zu Körpergewicht [11]. Das Gewicht der Athleten bedarf deshalb im Klettersport besonderer Aufmerksamkeit. Hochintensives sportliches Training, gepaart mit den objektiven Vorteilen eines niedrigen Körpergewichtes, kann im Klettersport Essstörungen begünstigen, die zu einem relativen Energiemangel im Sport (RED-S) führen [11]. Langfristige schwerwiegende Komplikationen können die Folge sein. Es ist bekannt, dass Spitzenkletterer einen niedrigeren BMI haben als Spitzensportler anderer Sportarten, selbst im Vergleich zu Langstreckenläufern [11]. Zusätzlich zum Fasten und zur Begrenzung der Kalorienzufuhr wurden in der Vergangenheit Appetitzügler und Diuretika eingesetzt, um das Körpergewicht zu kontrollieren. Als präventive Maßnahme gegen mögliche Essstörungen (RED-S) werden internationale Athleten daher von der medizinischen Kommission des IFSC auf ihren Body-Mass-Index (BMI) hin untersucht. Liegt der BMI unter den festgelegten Grenzwerten (weiblicher BMI 17,5, männlicher BMI 18,5), werden der jeweilige nationale Verband, der Mannschaftsarzt und der Athlet informiert. Alle Beteiligten müssen bestätigen, dass medizinische Hilfe und eine Therapie für eine mögliche Essstörung in Anspruch genommen werden [11]. Während Watts et al. jedoch darauf hingewiesen haben, dass diese BMI-Messungen ein ungeeignetes Screening-Instrument seien, wurde ein allgemeiner Mindest-BMI, wie er beispielsweise in Österreich für die Teilnahme an Kletterwettkämpfen erforderlich ist, von der IFSC Medical Commission noch nicht international festgelegt [11, 12]. Gronhaug berichtete kürzlich sogar, dass es nicht notwendig sei, einen niedrigen BMI zu halten, um beim Klettern ein Spitzenniveau zu erreichen. Diese Aussage ist jedoch fragwürdig, da nur ein sehr geringer Prozentsatz der analysierten Studiengruppe „Elite“ (3,5 %) oder „internationale Elite“ (0,2 %) war [13]. Zusammenfassend empfehlen wir daher eine verstärkte Überwachung und frühzeitige Detektion von untergewichtigen Athleten und eine weitere Auseinandersetzung mit dem Thema durch die nationalen und internationalen Sportverbände.
Anti-Doping
Im Einklang mit der rasanten Professionalisierung des Sports müssen auch die Anti-Doping Regularien stetig angepasst und überarbeitet werden [14]. Laut dem aktuellen Anti-Doping-Bericht der International Federation of Sport Climbing (IFSC) gab es bei den 124 Kontrollen, bei denen die IFSC als Kontrollinstanz fungierte, keinen einzigen Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen (96 Kontrollen im Wettkampf und 28 Kontrollen außerhalb des Wettkampfs) [15]. Auch in Tokio wurden keine positiven Fälle unter den Klettersport-Athleten erkannt. Dennoch könnten leistungssteigernde Substanzen wie Stimulanzien oder angstlösende/enthemmende Substanzen in allen drei Klettersport-Subdisziplinen zur Verbesserung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit eingesetzt werden [14]. Die verschiedenen Verbände haben daher standardisierte Anti-Doping-Bestimmungen aus anderen Sportarten übernommen, um Regelstandards zu entwickeln und umzusetzen. In vielen Nationen haben die Verbandsstrukturen im Wettkampfklettern jedoch noch kein professionelles Niveau erreicht, insbesondere im Hinblick auf die Anti-Doping-Beratung und -Betreuung. Eine ausreichende Betreuung und Beratung der Athleten ist daher nicht immer gewährleistet. Angesichts der Tatsache, dass das weltweite Interesse an der Sportart seit den olympischen Spielen noch weiter gewachsen ist, sollten Anti-Doping-Regelungen mit entsprechender Aufklärungsarbeit weiterhin oberste Priorität haben [14]. Wir befürworten aus diesem Grund die folgenden wesentlichen Antidoping-Maßnahmen:
- Verstärkte Anti-Doping-Aufklärung und sportmedizinische Betreuung von Leistungssportlern im Klettersport
- Verbesserte Zusammenarbeit verschiedener Sportverbände zur gegenseitigen Aufklärung über Doping sowie über entsprechende Anforderungen im Klettersport
- verstärkte Überwachung und Anti-Doping-Kontrollen
Fazit
Derzeit gibt es nur wenige gut konzipierte prospektive Kohortenstudien mit ausreichender Stichprobengröße. Langfristige Überwachungen von Spitzenathleten fehlen völlig. Im Klettersport wird eine qualitativ hochwertige epidemiologische Forschung benötigt, die sich an den empfohlenen Standards für die Datenerfassung und -berichterstattung orientiert. Hierfür sind Forschungsgelder erforderlich. Zudem wird es zunehmend wichtig sein, dass alle (nationalen) Kletterteams von gut ausgebildeten Sportmedizinern und Physiotherapeuten betreut werden. Die Kletterverbände müssen dafür die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen. Entsprechende finanzielle und personelle Ressourcen für medizinische Teams sind notwendig. Darüber hinaus ist es essentiell, dass die Verbände Maßnahmen und Regelungen im Hinblick auf Präventionskonzepte, insbesondere im Jugendleistungssport, festlegen und umsetzen. In Anlehnung an die bereits in anderen Sportarten ergriffenen Maßnahmen (z. B. „Pitch smart“-Bewegung im Baseball zur Reduzierung von Schulter-/Ellbogenverletzungen bei jugendlichen Sportlern) wären Vorgaben zur Belastungsbegrenzung im Jugendklettern zur Reduzierung von Fingerverletzungen denkbar. Trainer müssen entsprechend geschult und ausgebildet sein, um Überlastungsschäden und akute Verletzungen bei jungen Sportlern zu vermeiden.
Literatur bei den Autoren
Autoren
ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie Leiter der Sektion Sportorthopädie an der Klinik und Poliklinik für Orthopädie der Universitätsmedizin Rostock. Wissenschaftlich befasst er sich u.a. mit dem Thema Prävention von Sportverletzungen. Darüber hinaus ist er in der Betreuung der Deutschen Nationalkader sowie in der sportmedizinischen Betreuung internationaler Kletterwettkämpfe aktiv.
ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie mit Zusatzbezeichnungen spezielle Unfallchirurgie, Sportmedizin, Notfallmedizin. Er ist Leitender Arzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie des Zentrums Interdisziplinäre Sportmedizin am Klinikum Bamberg. Prof. Schöffl ist Verbandsarzt DAV und war von 2009 bis 2023 im MedCom IFSC.